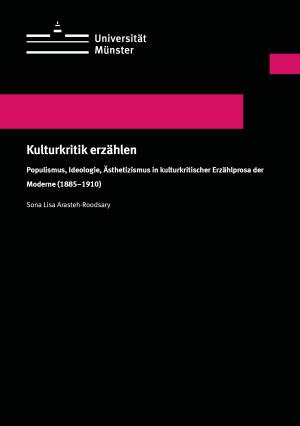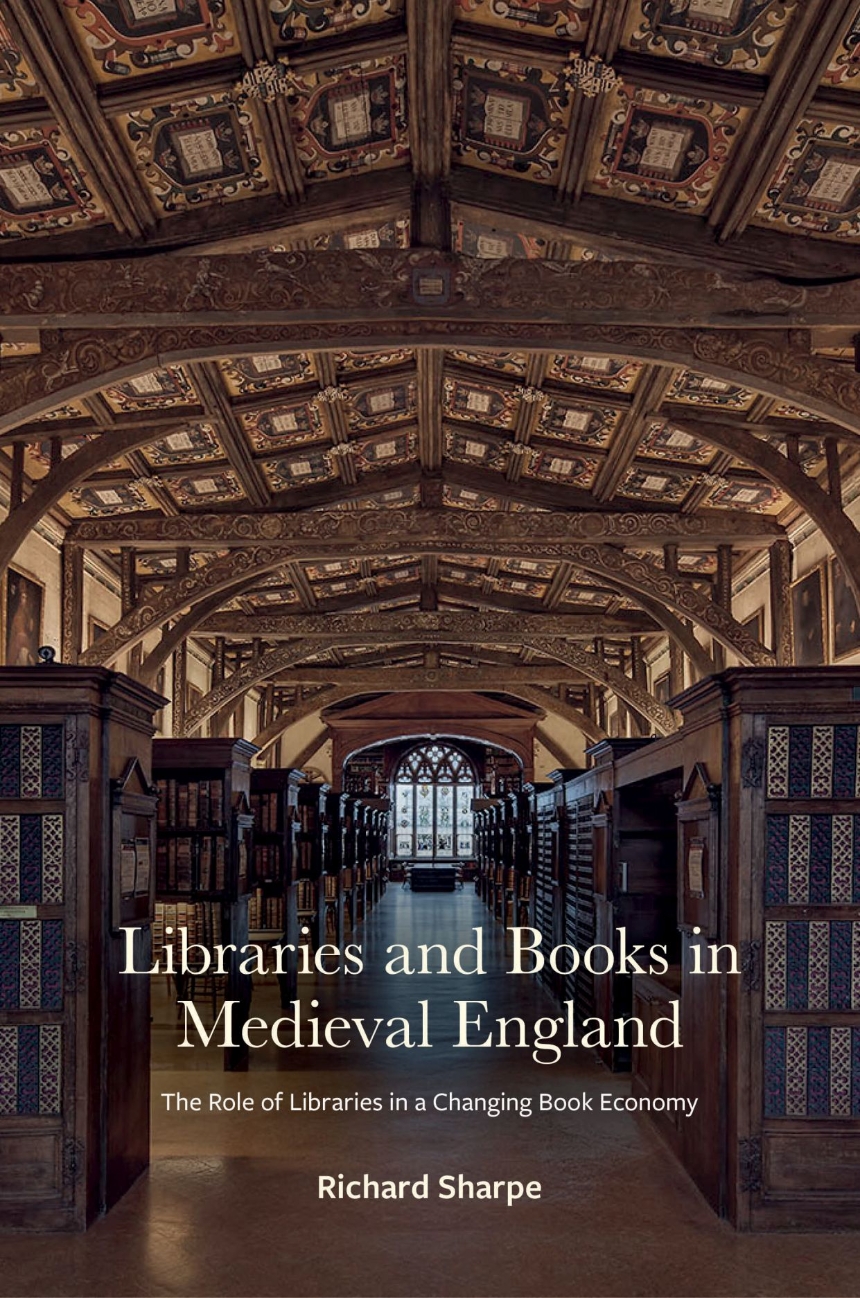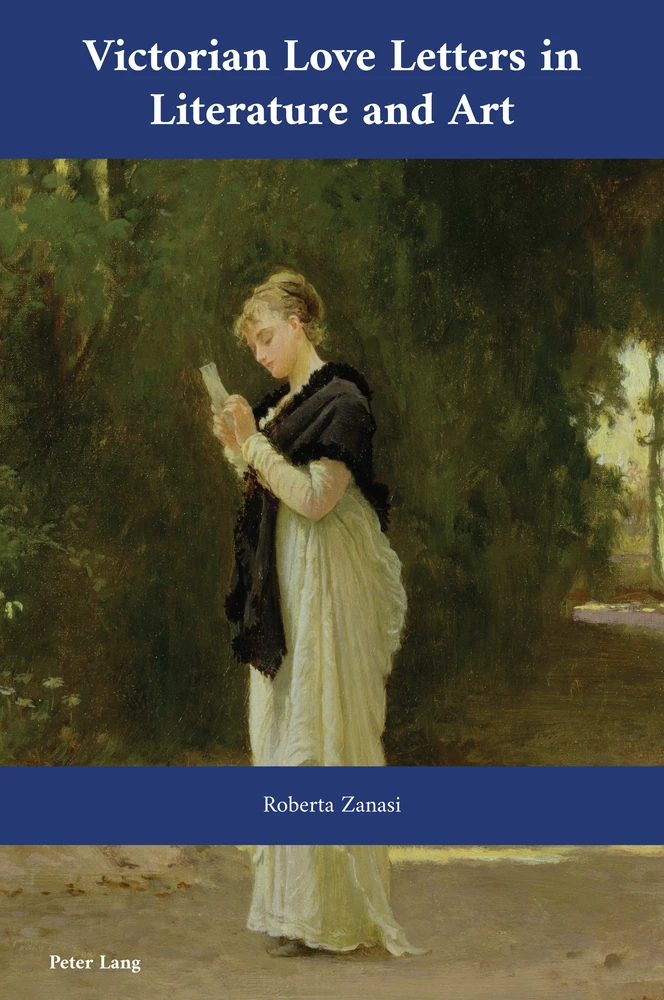Diese Podcast-Reihe wurde von der Stiftung EVZ initiiert:
Was hält eine Gesellschaft zusammen, wenn Bomben fallen? Wie bewahren Menschen ihre Würde, ihre Kultur und ihre Geschichten inmitten von Zerstörung? Dieser Podcast zeigt ein Land, das trotz Krieg nicht nur überlebt, sondern sich neu erfindet.
In vier Folgen spricht Ira Peter, die ehemalige Stadtschreiberin von Odesa, mit inspirierenden Gästen: mit Überlebenden von NS-Verbrechen, Museumsleiter:innen, die Kunstwerke vor Raketen schützen, jungen Menschen, die Brücken zwischen Deutschland und der Ukraine bauen, und Aktivist:innen der Rom:nja-Community, deren Stimmen oft ungehört bleiben.
Der Podcast beleuchtet, wie die Ukraine mit alten und neuen Traumata umgeht, Museen in digitale Räume verwandelt und eine widerstandsfähige Zivilgesellschaft formt. Jede Episode stellt Alltagsheld:innen und visionäre Projekte vor, die verdeutlichen, warum die Ukraine für Europa von zentraler Bedeutung ist.
Die Folgen erscheinen monatlich ab dem 19. Februar [2025] – auf unserem YouTube-Kanal, bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt.
entdeckt über die JOE-List